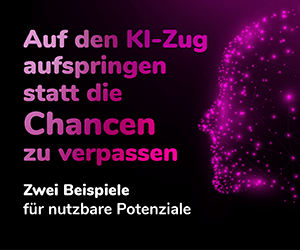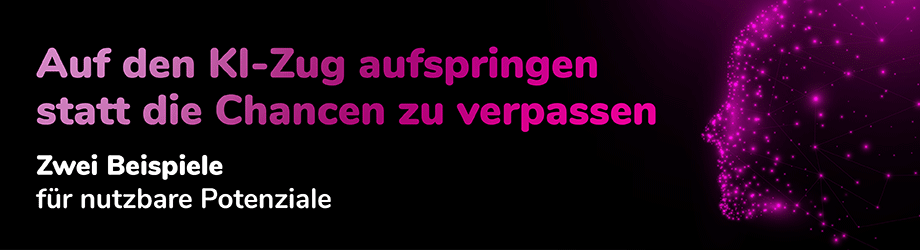Tief verborgen unter der Erde oder versteckt in dichten Wäldern zeugen die Sachsenbunker von den kriegerischen und politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Sachsenbunker: Zeitzeugen einer dunklen Vergangenheit
Ursprünglich während des Zweiten Weltkriegs errichtet, dienten viele dieser Schutzanlagen nach 1945 als strategische Stützpunkte für die Rote Armee und wurden nahtlos in die militärische Infrastruktur der DDR integriert.
Einige dieser Relikte sind gut erhalten, andere verfallen langsam und verschwinden nach und nach aus dem Bewusstsein der Menschen. Doch wer sich auf eine Spurensuche begibt, kann tief in die Geschichte eintauchen: Vom Schutzbunker gegen alliierte Luftangriffe bis hin zu geheimen Kommandostellen des Kalten Krieges erzählen diese Bauwerke von Zeiten, in denen Angst, Macht und Verteidigungsstrategien den Alltag bestimmten.
Während manche Bunker mittlerweile für die Öffentlichkeit zugänglich sind und Historikern sowie Interessierten einen Einblick in die Vergangenheit bieten, bleiben andere streng verschlossen oder verfallen in Vergessenheit. Eine Entdeckungstour durch die Sachsenbunker gleicht einer Zeitreise – eine Reise zu den Spuren der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte, die viel näher liegt, als manch einer glauben mag.
Ein Sachsenbunker als Ausweichführungsstelle
In Mittelsachsen gelegen ist dieser Sachsenbunker. Mit einer unterirdisch liegenden Nutzfläche von cirka 500 Quadratmetern sehr weitläufig ausgeführt, steht auf seinem Haupt überirdisch eine kleine Wohnanlage. Der Sachsenbunker liegt inmitten eines Obstgartens. Er trägt ein Doppelhaus, verschiedene Garagen und eine Werkstatt. In Innern der Ausweichführungsstelle sollten sich 100 Personen aufhalten. Der Sachsenbunker wurde in den Jahren von 1969 bis 1971 errichtet. Das Video zeigt die oberirdisschen Ziivilbauten und die unterirdsich gelegenen Gänge und Räume im Bunker. Der Standort: Mittelsachsen.
Ausweichführungsstelle bei Wildbach
Nahe der Zwickauer Mulde findet sich bei Wildbach nahe Hartenstein in Sachsen ein Bunker des Bunkertyp 1/15/V2c. Der Sachsenbunker wurde ursprünglich als Ausweichführungsstelle der Wismut in Aue errichtet. Zu Beginn der 80er Jahren wurde die Ausweichführungsstelle umgewidmet und vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR bis zur Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1989 genutzt.
Jüterbog: ein Bunker, fast in Sachsen gelegen
Historisch gesehen lag Jüterbog in frühe Zeiten in einer Enklave nahe dem Herzogtum Sachsen-Wittenberg. Das will ich für eine Aufnahme der Bauwerke in den Artikel Sachsenbunker noch gelten lassen. Als Story und Video haben wir hier die Artillerie-Schießschulen Jüterbog mitgebracht. Überirdische Bauwerke werden ebenso gezeigt wie echte Sachsenbunker – unterirdische Bauten.
Weiterführende Informationen über die Artillerieschulen findet man hier.
Ein sehr gut erhaltener Sachsenbunker aus der DDR-Zeit
Von diesem Sachsenbunker haben wir keine Fotos, dafür aber ein Video von der Besichtigung desselben durch die beiden Entdecker. Der Sachsenbunker liegt in … – darüber schweigen sich die beiden Entdecker aus. Im Video zeigen die beiden den guten Erhaltungszustand der Bunker-Anlage, deren Eingang völlig unscheinbar und kaum einen halben Meter hoch im Gras verborgen liegt. Die bedien möchten den Standort zum Sachsenbunker nicht preisgeben, denn viele Bunker werden von Vandalen heimgesucht und gebrandschatzt. In diesem Sachsenbunker sind fast alle Einrichtungen noch völlig intakt und diesen Zustand möchten die beiden unbedingt erhalten.
Die weißen Häuser bei Mirow
Mirow liegt nun nicht in Sachsen. Dennoch möchte ich sie hier erwähnen. Der Ort Mirow birgt ein weiteres und vor allem wenig bekanntes Stück deutscher Zeitgeschichte. Ich spreche von den weißen Häusern. Die Weißen Häuser liegen in einem Waldstück hinter Granzow und noch vor Roggentin. Das Areal ist zwischenzeitlich eingezäunt, weil ein Mädchen dort vor Jahren verunglückte und davon bleibende Schäden zurückbehielt. Eine Besichtigung ist daher heute nur aus der ferne möglich. Dennoch sehen die Bauwerke beeindruckend aus.
Die weißen Häuser gehörten zur Erprobungsstelle Rechlin, deren Anfänge auf das Jahr 1916 zurückgehen. Als Flieger-Versuchs- und Lehranstalt an der Müritz geplant und erbaut wurde in der 1930er Jahren der Flugplatzes Lärz einbezogen und Rechlin zur Erprobungsstelle („E’Stelle“) der Luftwaffe ausgebaut. Die Forschungsergebnisse der Tests und Entwicklungen dortigen Ingenieure beeinflussten die Luftfahrttechnik bis heute.

Kein Sachsenbunker steht in Mirow. Dafür aber eine Reihe von interessanten Bauwerken: die weißen Häuser. Das Bild zeigt Überreste eines Bunkers, genauer die Stahlbewehrung seiner Wand, der in der Nähe von Mirow in einem Waldgebiet liegt. (#1)
Die „Weißen Häuser“ gehen auf den Architekten Neufert als Normungsbaeuftragten des Generalbauinspektors Albert Speer sowie auf einen Architektenwettbewerb der Stadt Hamburg zurück. Die Weißen Häuser stellen Versuchsbauten des „Baulichen Luftschutz“ dar. Ziel des Wettbewerbs war es, Lösungen für die Vermeidung des Fußwegs von der Wohnung zum Luftschutzplatz zu finden. Einer der Ansatzpunkte dazu waren die sogenannten „Etagenbunker“, die Schutz innerhalb der Wohnung bieten sollten. Den Etagenbunkern wurde zu Friedenszeiten eine andere Nutzung zugeordnet, beispielsweise als Bäder, Abstellraum oder Treppenhäuser.
In Mirow wurden solche Etagenbunker zu Testzwecken in Rohbauten von Gebäuden auf den Versuchsgelände eingebaut, welche testweise mit Bomben und Sprengsätzen beschossen wurden. Sie bilden die „Weiße Stadt“ und wurden auch als „Germania-Probebauten“ bezeichnet. Die Fassaden der Weißen Häuser waren zum Zeitpunkt ihrer Errichtung verklinkert. Die Steine wurden jedoch in der Nachkriegszeit aus der Mauer des Bauwerks herausgebrochen und für den zivilen Häuserbau verwendet. Dies führte dazu, die helle Schicht der Mauer darunter freizulegen. Dieses Aussehen bescherte den Bauten den Spitznamen „Weiße Häuser“.
Video: Bunker-Testwände für Sprengversuche
Auf dem Gelände finden sich auch Betonwände, die für Beschusstests von Bunkerwänden genutzt wurden. Das nachfolgende Video zeigt einige der Betonwände, deren Oberfläche von den Beschusstests geborsten ist.
Sachsenbunker auf dem Truppenübungsplatz
Auf Truppenübungsplätzen finden sich immer wieder feste Bauwerke und Bunker. Beobachtungsstände, Signalbunker und Mannschaftsbunker. In dem nachfolgenden Sachsenbunker-Video führt die Kamera über einen aufgegebenen Truppenübungsplatz. Viele Fundstücke erzählen von der bewegten Vergangenheit des truppenübungsplatzes. Einige der Sachsenbunker werden betreten und man entdeckt kryptische Schriftzüge an den Wänden. Was mögen sie bedeuten?
Bunker Königsbrück: Geheime Troposphärenfunkstation im Kommunikationssystem BARS
Tief in den Wäldern Sachsens verbirgt sich ein Relikt des Kalten Krieges: die ehemalige Troposphärenfunkstation (303) in Königsbrück. Sie war ein zentraler Knotenpunkt im Kommunikationssystem BARS, das von der Sowjetunion genutzt wurde, um eine sichere und abhörsichere Funkverbindung zwischen wichtigen militärischen Einrichtungen herzustellen.
Die Anlage, verborgen in einem Bunkerkomplex, diente als Teil eines strategischen Netzwerks, das es ermöglichte, Nachrichten über große Distanzen hinweg zu übertragen – ohne auf Satelliten angewiesen zu sein. Diese Technologie war für das Militär von großer Bedeutung, da sie selbst unter widrigsten Bedingungen funktionierte und eine robuste, störungssichere Kommunikation garantierte.
Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland Anfang der 1990er Jahre wurde die Station aufgegeben, doch die Überreste der geheimen Funkanlage sind bis heute erhalten. Wer sich für die militärische Infrastruktur des Kalten Krieges interessiert, findet in Königsbrück ein faszinierendes Zeugnis dieser Epoche.
Bunker Taucherwald: Geheimnisvoller Ort in Sachsen
Der Taucherwald, gelegen bei Uhyst am Taucher in der Gemeinde Burkau, Sachsen, birgt ein Stück Zeitgeschichte, das bis in die Ära des Kalten Krieges zurückreicht. In den 1980er Jahren errichtete die Sowjetarmee hier einen Raketenstützpunkt, bekannt als Operationsbasis Bischofswerda. Zwischen 1984 und 1988 waren in diesem Gebiet SS-12-Raketen stationiert, die mit nuklearen Sprengköpfen ausgestattet waren.
Der Stützpunkt umfasste mehrere Bunker und weitere militärische Einrichtungen. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen im Jahr 1991 wurde der Taucherwald wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute zeugen die Überreste der Bunkeranlagen von dieser bewegten Vergangenheit. Interessierte können auf dem Taucherwald-Rundweg die historischen Relikte erkunden und mehr über die Geschichte des Ortes erfahren.
Der Taucherwald steht somit als Mahnmal für eine Zeit, in der die Welt am Rande eines nuklearen Konflikts stand, und erinnert daran, wie wichtig der Erhalt des Friedens ist.
Bunker Granit 1 am Flugplatz Großenhain: Geheimes Lager für Kernwaffen während des Kalten Krieges
Der Bunker Granit 1 auf dem Gelände des Flugplatzes Großenhain war während des Kalten Krieges ein streng geheimes Sonderwaffenlager der sowjetischen Streitkräfte. Diese speziell gesicherte Bunkeranlage diente der Lagerung von Kernwaffen und war Teil der militärischen Infrastruktur der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD).
Geschichte und Funktion
- Bauzeit und Zweck: Zwischen 1972 und 1974 errichtet, wurde der Bunker zur sicheren Aufbewahrung von Kernwaffen genutzt. Die Fertigteile für den Bau wurden aus Geheimhaltungsgründen nachts aus der damaligen Volksrepublik Polen angeliefert.
- Militärische Nutzung: Der Flugplatz Großenhain beherbergte die 105. Jagdbombenfliegerdivision der GSSD. Im Kriegsfall sollten Flugzeuge mit atomarer Munition Ziele im feindlichen Hinterland angreifen.
Aufbau der Bunkeranlage
- Struktur: Die Anlage bestand aus zwei Bunkern, die aus kreisförmigen Betonfertigteilen zusammengesetzt waren, ähnlich dem Bau eines Tunnels. Jeder Bunker verfügte über einen eigenen Maschinenraum und war mit stählernen Drucktüren gesichert. Eine Verladerampe verband die beiden Bunker.
- Sicherheitsmaßnahmen: Das Gelände war dreifach eingezäunt, wobei der innerste Zaun aus aufgestellten Sandblechen und die äußeren Zäune aus Stacheldraht bestanden. Nachts wurde das gesamte Areal vollständig beleuchtet. Die Bewachung übernahm eine Spezialeinheit des sowjetischen Geheimdienstes KGB.
Heutige Nutzung
- Nach der Wiedervereinigung: Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen bis 1993 wurde der Flugplatz an den Freistaat Sachsen übergeben.
- Aktuelle Nutzung: Im Jahr 2000 übernahm ein militärhistorisch interessierter Bürger das ehemalige Sonderwaffenlager und versetzte es weitestgehend in den originalen Zustand. Seit 2004 steht der Bunkerkomplex unter Denkmalschutz. Heute befindet sich im Bunker Nummer 1 eine Ausstellung zur Geschichte des Flugplatzes Großenhain von 1913 bis zur Gegenwart.
Bunker Gersdorf: Geheime Lagerstätten für Kernwaffen in Sachsen
Der Bunker Gersdorf war eine geheime militärische Anlage in Sachsen, die während des Kalten Krieges als Lagerbunker für Kernwaffen diente. Solche Einrichtungen wurden strategisch platziert, um im Ernstfall einen schnellen Zugriff auf atomare Waffen zu gewährleisten. Der Bunker Gersdorf gehörte zu einer Reihe von Bunkeranlagen in Deutschland, die für die Lagerung und den Schutz von Kernwaffen konzipiert waren.
Diese Bunker waren oft tief unter der Erde angelegt und mit robusten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, um sowohl vor äußeren Angriffen als auch vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Existenz solcher Anlagen wurde meist streng geheim gehalten, und erst nach dem Ende des Kalten Krieges wurden Informationen darüber öffentlich zugänglich.
Heute sind einige dieser ehemaligen Bunkeranlagen für die Öffentlichkeit zugänglich und dienen als Mahnmale oder Museen, die an die Spannungen und Gefahren des Kalten Krieges erinnern. Sie bieten einen Einblick in die militärische Strategie und Infrastruktur jener Zeit und ermöglichen es Besuchern, die Geschichte hautnah zu erleben.
Bunker Kossa-Söllichau: Geheime Führungsstelle des Territorialen Militärbezirkes III / Leipzig
Der Bunker Kossa-Söllichau war eine streng geheime Führungsstelle des Territorialen Militärbezirkes III (TMB III) der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. Dieser Militärbezirk umfasste das Gebiet Sachsens und Teile Thüringens und diente als zentrale Kommandostruktur für militärische Operationen und Verteidigungsstrategien im Kriegsfall.
Die Anlage wurde zwischen 1976 und 1983 als geschütztes Führungszentrum ausgebaut und wäre im Spannungsfall die operative Kommandozentrale für die Militärführung der DDR in dieser Region gewesen. Der Bunker war mit modernster Technik ausgestattet, um auch unter Extrembedingungen handlungsfähig zu bleiben. Nach der Wende wurde er stillgelegt, ist aber heute als Museum zugänglich und gibt einen tiefen Einblick in die militärische Geheimwelt des Kalten Krieges.
DDR-NVA-Bunker nahe VW-Werk Mosel: Verborgene Relikte militärischer Geschichte
In unmittelbarer Nähe des heutigen Volkswagenwerks im Zwickauer Stadtteil Mosel befindet sich eine ehemalige Bunkeranlage der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. Dieses Bauwerk diente als Nachrichtenhilfszentrale 64 (NHZ-64) und war Teil der militärischen Infrastruktur zur Zeit des Kalten Krieges.
Geschichte und Funktion:
Der Bunker wurde als Führungsstelle der NVA genutzt und war für die Sicherstellung der Kommunikation im Verteidigungsfall verantwortlich. Mit robusten Schutzmaßnahmen ausgestattet, sollte er auch im Falle von Angriffen funktionsfähig bleiben.
Lage und heutige Nutzung:
Die Anlage befindet sich in einem Waldstück nahe der Lauenhainer Straße, unweit der Bundesstraße 93. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands verlor der Bunker seine militärische Bedeutung. Heute steht er als Relikt vergangener Zeiten und erinnert an die militärische Präsenz in der Region.
Bedeutung für die Region:
Der Bunker nahe dem VW-Werk Mosel ist ein Zeugnis der militärischen Strategien und Bauwerke während der DDR-Zeit. Für Geschichtsinteressierte bietet er Einblicke in die militärische Vergangenheit und die Bedeutung der Region im Kontext des Kalten Krieges.
Aktueller Zustand:
Obwohl der Bunker nicht öffentlich zugänglich ist, bleibt er ein interessantes Objekt für Forschungen und Dokumentationen zur Geschichte der DDR und ihrer militärischen Einrichtungen.
Diese Anlage verdeutlicht die strategische Bedeutung Sachsens während des Kalten Krieges und erinnert an eine Zeit, in der solche Bunker integraler Bestandteil der Landesverteidigung waren.
Bildnachweis: © shutterstock – Titelbild Wakllaff, #1 guentermanaus